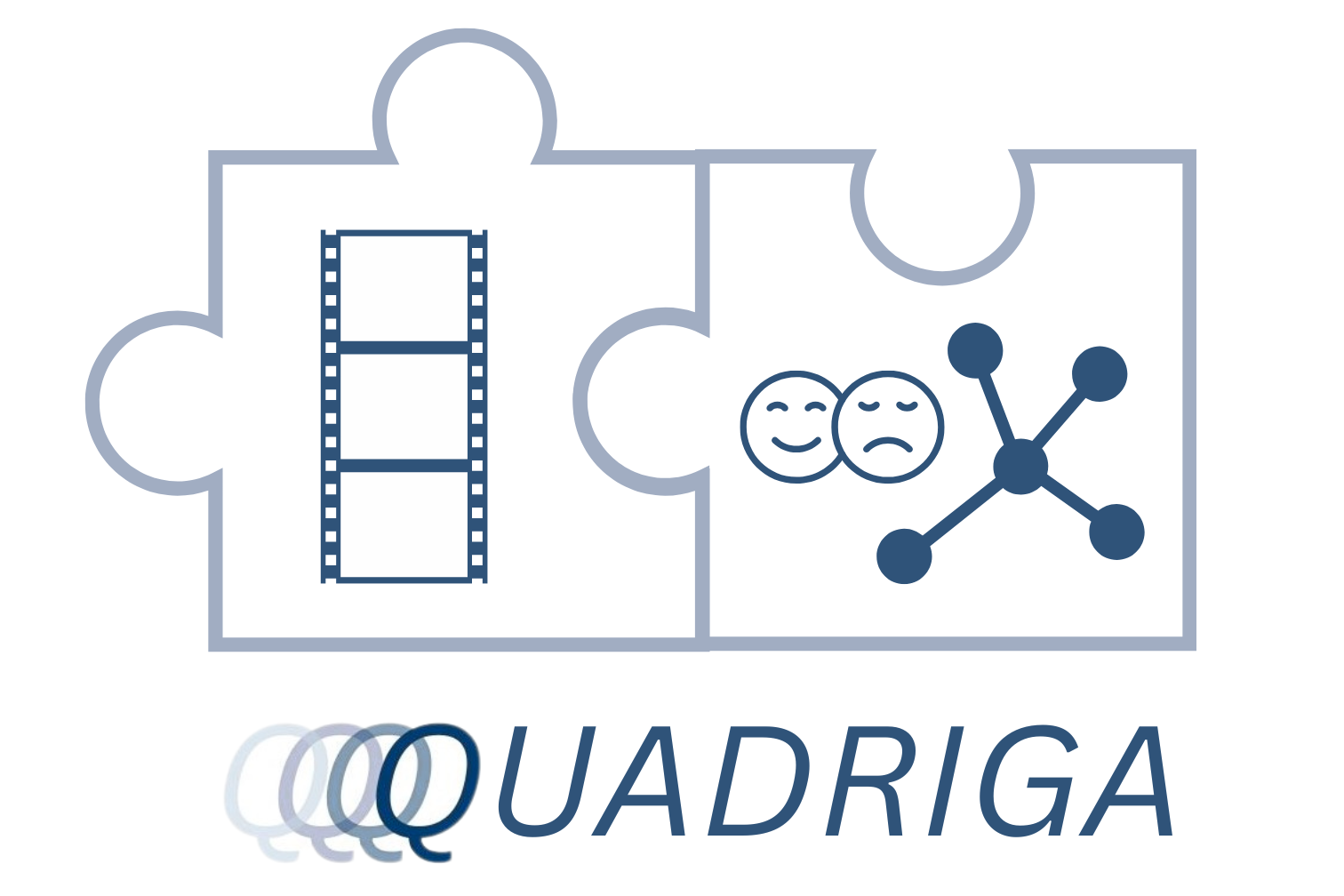2.1. Einführung in die datengestützte Filmanalyse und Forschungsfragen#
Videoinhalte spielen auf den Plattformen der sozialen Medien eine immer stärkere Rolle – nicht nur in Fragen der Unterhaltung, sondern auch der politischen Meinungsbildung. Die Klimakrise als eines der wichtigsten gesellschaftlichen Themen und Konflikte unserer Zeit ist dabei keine Ausnahme. Umfangreich und heterogen sind die Diskurse, in denen die Krise mit Bewegtbildern kommuniziert und die Kommunikation dieser Krise selbst kommentiert, reflektiert, verstärkt oder unterdrückt wird. Das zentrale Telos dieser Videoinhalte ist nur zu einem kleinen Teil der Wissenstransfer und das Verstehen wissenschaftlicher Erkenntnisse. Vielmehr spielen Fragen der Emotionalisierung sowohl im Hinblick auf politische Meinungsbildung oder aktivistische Mobilisierung als auch in Hinblick auf Klimaleugnung und rechter Propaganda eine zentrale Rolle.
Die Genres und Formate von klimabezogenen Videos sind hochgradig divers und ihre Clusterung unterscheidet sich zwischen den großen Plattformen. Oftmals lassen sich die kürzeren Videos nach den dominanten Modalitäten und Verfahren klassifizieren: Infografiken und Animationen, einzelne sprechende Personen oder Dialoge, Text in Verbindung mit Musik oder Musik in Verbindung mit Montagen von Naturmotiven oder Nachrichtenausschnitten, Aufzeichnungen von Protestaktionen uvm.– wobei ein beträchtlicher Anteil der Videos, insbesondere mit steigender Länge, aus Mischformen besteht (Zeng and Yan, 2024).
Wie aber lassen sich die Verfahren der affektiven Adressierung von Zuschauenden in diesen Videos empirisch greifen? In der Forschung steht dazu eine Vielzahl verschiedener Methoden zur Verfügung. Zum einen gibt es Analysemethoden der sentiment analysis und des topic modelling, die auf sprachliche Inhalte oder Bildinhalte zugreifen, sie codieren und bestimmte Cluster nach vorher festgelegten Wertungen statistisch auswerten (O'Neill, 2020). Wobei aufgrund eines konstitutiven text-bias der Digital Humanities die Zahl der Arbeiten, die sich etwa bei Youtube eher auf die Kommentare denn auf die Videos fokussieren, ein deutliches Übergewicht hat (Tereick, 2016), (Kang et al., 2024). Zum anderen lassen sich an empirischen Zuschauer:innen affektive und einstellungsbezogene Wirkungen erfragen und vergleichen – wobei der direkte Impact einzelner Videos im Verhältnis zur langfristigen, wiederholten Rezeption bestimmter Adressierungen durch diese Verfahren kaum messbar ist (Walton et al., 2021). Keine dieser Herangehensweisen betrachtet aber die grundlegende medienästhetische Qualität von Videos als zeitlich sich entfaltenden, audiovisuellen Bewegtbildern in den Blick.
Hier setzt die vorliegende Fallstudie an: Sie geht von der Prämisse aus, dass Filme und Videos als expressive und zeitbasierte Medien beschrieben werden können (Kappelhoff, 2004), (Bakels et al., 2023). Unter Rückgriff auf empirisch grundierte Methoden können audiovisuelle Bewegtbildmedien folglich systematisch auf die ihnen zugrunde liegenden temporalen und multimodalen Dynamiken hin analysiert werden. Diese Vorgehensweise ermöglicht es, audiovisuelle Inhalte somit nicht unter narrativen oder inhaltsanalytischen Gesichtspunkten zu untersuchen, sondern in ihrer audiovisuellen, temporalen Struktur zu segmentieren, beschreiben und qualifizieren und so den Fokus auf die medienästhetische Gestaltung, d. h. auf ihre Wahrnehmungsmuster und die damit verbundenen Emotionalisierungsstrategien (z.B. mit Blick auf Kamera- und Figurenbewegung, Bildkomposition, Farbgebung, Lichtsetzung, Soundscapes usw.), zu setzen. Die intendierten Emotionalisierungsstrategien politisch motivierter Videos zur Klimakrise auf der vielseitig genutzten Videoplattform YouTube sind Untersuchungsgegenstand der vorliegenden filmanalytischen Fallstudie. Über die Kombination von (semi-) automatisierten und manuellen Annotationen sollen die intendierten Emotionalisierungen systematisch rekonstruiert sowie visualisiert und als Strategien einer Affektrhetorik qualifiziert werden (Grotkopp, 2021). Die Studie gestaltet sich exemplarisch entlang der Auswahl eines konkreten und wiederverwendbaren Beispiels, um die Methoden und Probleme des Ansatzes transparent und zugänglich zu machen.
2.1.1. Zentrale Forschungsfragen und Aufgaben#
Die Fallstudie umfasst drei zentrale Forschungsfragen, die durch die hier vermittelten Lernmodule adressiert werden sollen:
Inwiefern lassen sich politische Zielsetzungen in audiovisuellen Diskursen auf die ihnen zugrunde liegenden Inszenierungsmuster bzw. die mit diesen Inszenierungen intendierten Affizierungen beziehen?
Wie können datengestützte Methoden für die Qualifizierung von filmwissenschaftlichen Analysen nutzbar, weiterverbreitbar und zugänglich gemacht werden?
Inwiefern können durch empirisch hergestellte quantifizierbare Daten Aussagen über die Qualifizierung audiovisueller Inszenierungsdynamiken und den damit verbundenen Affizierungen getroffen werden?
An einem exemplarischen Video sollen in einem dreistufigen Prozess filmanalytische Daten hergestellt werden, anhand derer sich Aussagen über die Inszenierungsdynamiken in Bezug auf intendierte Affizierungen treffen lassen.
Subjektive Einordnung der Daten vs. quantitative Erhebung
Eine wichtiges Anliegen der Fallstudie ist es, die Emotionalisierung als subjektives Erleben in Relation zu quantifizierbaren, objektivierbaren Metadaten zu setzen, d.h. die Bedeutung der Visualisierungen und der qualifizierenden Beschreibung audivisueller Bilder als einen notwendigen Schritt anzusehen, um diese Subjektivierungseffekte des Filme-Sehens überhaupt erst greifen zu können. Daher ist es im Rahmen der Fallstudie wichtig, die erhobenen Datensätze stets qualifizierbar zu machen.
Die zentralen Aufgaben der Fallstudie umfassen:#
Filmwissenschaftliche Methoden als digitale Methoden verständlich zu machen.
Die Übertragung basisschematischer Ansätze der Filmanalyse in webbasierte Semantik nach Semantic Triple Prinzipien.
Ein grundlegendes Verständnis für digitale Annotationsarbeit (timeline based video analysis) zu schaffen.
Die Qualifizierung der Annotationsmetadaten im Sinne der Dateninterpretation im Kontext der Fragestellung der Fallstudie zu intendierten Emotionalisierungen.
2.1.2. Literatur#
Bakels, J.-H., Grotkopp, M., Scherer, T., & Stratil, J. (2023). Screening the Financial Crisis: A Case Study for Ontology-based Film Analytical Video Annotations. Accessed: 2025-03-04.
Grotkopp, M. (2021). Zur audiovisuellen Rhetorik der Klimakrise. Mediaesthetics – Journal of Poetics of Audiovisual Images. doi:https://doi.org/10.17169/mae.2021.89
Kang, S., Choi, Y.-H., & Cheon, M. (2024). Ujikawa, K., Ishiwatari, M., & Hullebusch, E. v. (Eds.). Unraveling YouTube Stances on Global Warming: An In-Depth Analysis of Skeptics and Believers. Environment and Sustainable Development. Singapur: Springer.
Kappelhoff, H. (2004). Matrix der Gefühle. Das Kino, das Melodram und das Theater der Empfindsamkeit. Berlin: Vorwerk 8.
O'Neill, S. (2020). More than Meets the Eye: A Longitudinal Analysis of Climate Change Imagery in the Print Media. Climatic Change, 163(1), 9–26. doi:10.1007/s10584-019-02504-8
Tereick, J. (2016). Klimawandel im Diskurs. Multimodale Diskursanalyse crossmedialer Korpora. Berlin/Boston: De Gruyter.
Walton, P., Painter, J., Diblasi, T., & Ettinger, J. (2021). Climate of Hope or Doom and Gloom? Testing the Climate Change Hope vs. Fear Communications Debate through Online Videos. Climatic Change, 164(19). doi:10.1007/s10584-021-02975-8
Zeng, J., & Yan, X. (2024). Understanding Climate-related Visual Storytelling on TikTok: A Cross-National Multimodal Analysis. Journal of Digital Social Research, 6(2), 66–84. doi:10.33621/jdsr.v6i2.212